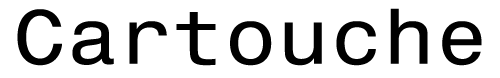Month: August 2011
//Review
Das Berliner Video-Projekt Videokills versteht sich als Plattform für internationale Videokunst. Am Mittwoch fand die fünften Ausgabe der Videokills-Reihe „The Explorer Series: Invisible City Symphonies“ im Marie Antoinette statt, in deren Rahmen Kurzfilme vertont werden.
Der Bogen 47 an der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte hat viele Gesichter. Das ganze Jahr über finden hier Firmenfeten, Hochzeiten und Record-Release-Partys statt. Die Privatveranstaltungen sind aber nicht alles: Der Bogen 47 beheimatet auch die stadtbekannte Musik-Venue Marie Antoinette.
Am Mittwoch flimmerten Stummfilme über die weißen Wänden des bogenförmigen Raums, unterlegt mit Livemusik. Anlass war die fünfte Ausgabe der Videokills-Reihe „The Explorer Series: Invisible City Symphonies“. Die New Yorker Videokünstlerin Julia Hurvich hatte MusikerInnen aus Berlin eingeladen, zeitgenössische Kurzfilme aus ihrer Sammlung zu vertonen.
Das Videokills-Projekt gibt es seit Februar 2009. Damals hatte Hurvich noch zwei Partnerinnen, Emma Pike und Tiphaine Shipman. Gemeinsam organisierten sie mehrere Kurzfilmabende und brachten ihr eigenes Video-Fanzine „The Postraum“ heraus. Videokills sollte eine Vernetzungs- und Ausstellungsplattform für internationale Videokunst sein. 2010 gingen Pike und Shipman zurück nach Australien, seitdem arbeitet Hurvich solo.
Auf sich allein gestellt entwickelte sie ein neues Konzept: Die Live-Vertonung von Kurzfilmen. Inspirieren ließ sie sich von dem russischen Stummfilm „Der Mann mit der Kamera“. Darin hielt der russische Regisseur Dziga Vertov das Leben einer sowjetischen Großstadt fest, es gab weder Handlung noch Schauspieler. Eine ähnlich experimentelle Reproduktion der Atmosphäre der Großstadt ist auch das Ziel der „Invisible City Symphonies“.
Im Juli 2010 fand die erste Ausgabe der Reihe in Brooklyn statt, es folgten Aufführungen in Barcelona und London. Dort arbeitete Hurvich immer mit MusikerInnen aus den jeweiligen Städten zusammen. Der Arbeitsprozess lief dabei jedes Mal gleich ab: Jedem Musiker, den Hurvich für geeignet hält, schickt sie eines ihrer Videos zu. Danach ist alles Vertrauenssache: „Ich höre mir die komponierten Stücke nie vorher an“, berichtet Hurvich. Das sei Teil des Konzepts. Böse Überraschungen habe sie bisher nicht erlebt.
Auch dieses Mal wurde Hurvich nicht enttäuscht. Der Berliner Musiker und Galerist Robin Löhr alias Black2 gab den Auftakt mit seiner Kollage verschiedener Samples selbst gespielter Klavierwerke, die er auf 20 Beats per Minute runterpitchte. Sein Stück komplementiere eindrucksvoll die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Videos „Berlin Found Footage“ der US-amerikanischen Künstlerin Jenna Levine. Den verschiedenen Sequenzen versuchte Löhr ein bestimmtes Sample zuzuordnen.
Eine andere Herangehensweise hatten Kathy Kwon und Molly Morgan. Den Ausgangspunkt ihres Beitrags bildete das Gedicht „On the Difficulty of Imaging an Ideal City“ des Schriftstellers George Perec. Dieses habe „perfekt“ zu dem Inhalt des Videos gepasst, in dem Coney Island zu sehen ist. Das Gedicht, das eine nüchterne Auflistung von verschiedenen Orten ist, an denen der Autor gern leben würde, versuchten sie mit einem „übertrieben sentimentalen“ Instrumentalstück zu kontrastieren. Die Darbietungen wurden durch das Ambiente des Raums hervorragend ergänzt.
(Fotos: Elizabeth Skadden)
Links: videokills / marie antoinette
//Playlist
Welche Songs und Alben begleiten unsere HeldInnen durch ihren Alltag? Diese Frage stellten wir verschiedenen ProtagonistInnen aus der Berliner Musik- und Modeszene. Sie verrieten uns nicht nur, was sie an den entsprechenden Liedern fasziniert, sondern auch, welche Erlebnisse sie mit ihnen verbinden. Das Resultat dieser Interviews ist unsere neue Serie //Playlist. Den Auftakt gibt der Berliner Musikjournalist, Fotograf und DJ Maximilian Bauer alias Max Dax. Seit kurzem betreut er als Chefredakteur die Telekom-Zeitschrift Electronic Beats Magazine. Dort hat er sich Großes vorgenommen: Gemeinsam mit seinem prominent besetzten Team, zu dem unter anderem der Publizist Hans-Ulrich Obrist zählt, will Max Dax Mediengeschichte schreiben.
Popol Vuh: »In den Gärten Pharaos«
Max Dax: Die deutsche Krautrockband Popol Vuh, die von 1970 bis zum Tod ihres Gründers Florian Fricke 2001 zusammen spielte, hat die Scores für fast alle Filme Werner Herzogs komponiert – darunter »Fitzcarraldo«, »Herz aus Glas« und »Aguirre, der Zorn Gottes«. Auf einer kürzlich veröffentlichten Compilation mit dem Titel »Revisited & Remixed 1970-1999« begegnete ich dem Track »In den Gärten Pharaos« wieder – er stammt vom gleichnamigen Album von 1971. Ich hatte das Stück längst vergessen. Es wiederzuhören war mindblowing, weil es Schlüsse darüber zulässt, was heutiger Musik fehlt: Der Geist der Nichtfunktionaliät. Popol Vuh spielen eine hochinteressante Instrumentalmusik unter Verzicht jeglicher herkömmlicher Melodik – stattdessen hören wir übereinandergeschichtete Layer von Soundflächen und Perkussion. Das 17-minütige Ergebnis eignet sich perfekt für nächtliche Autofahrten durch Bodennebel mit begrenzter Sicht. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes bewusstseinserweiternd.
________________________________________________________________
Bob Dylan: »Can’t Wait«
Den Song hat Dylan im Juni 2011 in Mailand gespielt. Eine so düstere Performance habe ich von ihm selten zuvor gesehen. Es war, als träfen David Lynch und Screamin‘ Jay Hawkins aufeinander. Dylan war eine vollkommen andere Person in diesem Moment, als sei er ein Medium, über das ein verstorbener schwarzer Musiker mit unserer Welt kommuniziert. Ich war erstaunt zu sehen, wie einfach solcherlei Verwandlungen auf der Bühne offenbar stattfinden können. Wie eine Person, die man schon unzählige Male live gesehen hat, einen so überraschen kann. Die Live-Version hatte im Übrigen gar nichts mehr mit der Albumversion zu tun. So etwas finde ich toll, das ist situative Musik. Diese Verwandlungsfähigkeit ist das, was der Jazz einst hatte und ihm heute fehlt und was auch anderswo kaum noch zu hören ist. Das ist ein Grund dafür, warum mich recorded Musik heute oft langweilt und weswegen ich nichtfunktionale DJ-Sets, in denen es nicht bloß um Beat-Matching geht, sondern um eine Ausweitungen der Kampfzone, oft so faszinierend finde. Dan Snaith ist ein Meister dieser DJ-Methode. Bei seinen Sets ist es möglich, mit der Stimmung mitzugehen.
________________________________________________________________
Tyler, the Creator: »Goblin«
Die Platte ist genial. Abgesehen von ihrem Bass und ihrer Langsamkeit fasziniert mich ihre sprachliche Ebene. Tylers Texte sind comic-haft verzerrt: Es wird hier gar nicht mehr von Streits berichtet, sondern gleich umgebracht. Solche Darstellungen entbehren jeglicher Relation zur wirklichen Welt. Es handelt sich um Ghetto-Nachrichten in Kunstsprache. Mein persönlicher Höhepunkt der Platte ist der Song »Goblin«, in welchem Tyler unentwegt über Schwule schimpft, sich also so homophob zeigt, wie es schlimmer nicht geht. Irgendwann in der Mitte bemerkt er dann: »By the way: I’m not homophobic«. Das ist fantastisch, ätzend und um die Ecke gedacht zugleich. Tylers Berichterstattung aus dem Ghetto ist so absurd, das man hier von Kunst sprechen kann. Wenn eine Platte ein ›Hub‹ zu neuen Erkenntnissen sein kann, reicht mir das oft schon. Aber wenn die Musik dann auch noch so toll ist, dann kommt alles zusammen. Ich kann mich gar nicht satt hören an Tylers Songs.
(Photo: Luci Lux)