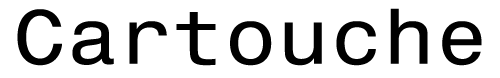Der Bart ist das erste, das einem an CHRISTOPHER KLINE auffällt. Struppig ist er, blond und so üppig, dass man das Gesicht des schlaksigen Musikers aus New York dahinter nur noch erahnen kann. Nicht minder bemerkenswert sind CHRISTOPHERS Liveshows. Wenn er auf die Bühne klettert und sich in HUSH HUSH verwandelt, ist der sonst eher zurückhaltende Musiker nicht mehr zu bändigen. Angespornt von Discosounds aus seinem IPOD singt er in höchstem Falsett, verrenkt dabei seinen Körper in den undenkbarsten Winkeln, springt auf Boxen herum und robbt auf Knien durchs Publikum. 2006 kam CHRISTOPHER nach Berlin, spielte seitdem in mehreren Bands und betreibt gemeinsam mit seiner Freundin SOL die Galerie KINDERHOOK & CARACAS und den Verlag FEATHER THROAT. Im Chat mit CARTOUCHE sprach der umtriebige Künstler über sein Leben in Berlin, sein Projekt HUSH HUSH und die Notwendigkeit, seinem Publikum das gewisse Extra zu geben.
CHRISTOPHER, herzlich willkommen im ETHERPAD!
CHRISTOPHER: Vielen dank, das Pad ist cool, ich benutze es heute zum ersten Mal!
ETHERPAD ist ein Online-Textprogramm, an dem mehrere Personen gleichzeitig arbeiten können. Aber ist es nicht komisch für dich zu chatten? Wir hätten uns auch treffen und uns bei einer Tasse Kaffee unterhalten können.
Ich kann mich mit beidem arrangieren. Meine Ideen sind in der Regel aber besser strukturiert, wenn ich sie aufschreibe. Außerdem scheint das Pad etwas „realer“ zu sein als ein richtiger Chat, weil du mir dabei zuschauen kannst, wie ich jeden einzelnen Buchstaben in das Pad eingebe.
Das stimmt. Auf FACEBOOK bekommt man immer nur die fertige Nachricht. Der Schreib- oder Denkprozess bleibt aber im Verborgenen. Bist du ein FACEBOOK-User?
Ich würde nicht so weit gehen, mich als FACEBOOK-User zu bezeichnen. Zwar habe ich seit zwei Jahren einen Account. Den benutze ich aber vor allem dafür, meine Shows und Ausstellungen anzukündigen oder Musik zu empfehlen. Mit meinen FACEBOOK-Freunden habe ich bis heute noch nie gechattet. Auch wenn ich versuche FACEBOOK zu meiden, verbringe ich dennoch viel Zeit im Internet – eine lästige Beschäftigung.
Warum?
Ich brauche es für meine Projekte. Das Internet ist der schnellste Weg, um Dinge zu organisieren und mit Leuten zu kommunizieren. Trotzdem weiß ich, dass das Internet nicht alles kann. Auch wenn die Welt immer virtueller wird, ist der Kontakt mit Menschen in der realen Welt immer noch der Aspekt, der darüber entscheidet, ob dein Projekt erfolgreich ist oder nicht. Leute zu treffen, Teil einer Community zu sein und auf Tour zu gehen ist gerade am Anfang extrem wichtig. Für kreative Menschen ist es daher unabdingbar in einer großen Stadt zu leben.
Ist das der Grund, warum du nach Berlin gekommen bist?
Nicht wirklich. Mich reizt an Berlin, dass man hier sehr gut an Ideen arbeiten kann. Das liegt vor allem daran, dass der Konkurrenzdruck in Berlin nicht sehr groß ist. Ironischerweise ist das aber nicht nur positiv. Im Gegenteil kann einem die Lockerheit Berlins schnell das Genick brechen. Auf einmal sind drei Jahre um und man hat nichts geschafft von dem, was man sich ursprünglich vorgenommen hatte.
Ich glaube, das Problem kennen viele. Wie ist es dir ergangen?
Ich habe nicht viel Zeit verplempert. Seit meinem Umzug nach Berlin 2006, habe ich vieles ausprobiert: Ich betreibe die Galerie KINDERHOOK & CARACAS sowie den Verlag FEATHER THROAT, habe in verschiedenen Bands gespielt und mehrere Bildbände publiziert.
Wann hast du mit HUSH HUSH angefangen?
HUSH HUSH begann als Fingerübung im Sommer 2009. Um mich von meinen ernsteren Musikprojekten abzulenken, nahm ich mehrere Loops mit meiner Loopstation auf, die ich mit meinem alten Drumcomputer, einem Casio-Keyboard und einigen Gitarren einspielte. Sechs Monate ließ ich diese Aufnahmen ruhen, bis mich eines Tages die Band YEASAYER in einer Mail fragte, ob ich nicht mit ihr auf Tour gehen wollte.
Und das wolltest du.
Richtig! Sie sind schließlich gute Freunde von mir, deren Arbeit ich sehr schätze. Ich dachte kurz darüber nach, mit welchem Projekt ich antreten wollte und entschied mich für die Loops, die ich ein halbes Jahr vorher aufgenommen hatte. Bis zur Tour blieben mir nur drei Wochen Zeit. Ich arbeitete Non-Stop, überlegte, was ein guter Popsong braucht und welchen Charakter ich auf der Bühne verkörpern wollte. Ich verlor damals fast den Verstand, schlief wenig, war dann aber sehr zufrieden mit dem Resultat.
Was braucht denn ein guter Popsong?
Ein wirklich außergewöhnlicher Popsong muss sich gut einprägen können. Das bedeutet, dass er eine traditionelle Liedstruktur haben muss, einen originellen Sound, eine gute Stimme und Worte, von denen sich die Leute angesprochen fühlen. Dann ist da noch dieser Funke, der schwer in Worte zu fassen ist, der aber einen guten von einem schlechten Popsong unterscheidet. Ich habe mir eine Menge Pop und Hip-Hop-Songs angehört, um das herauszufinden. „What’s Going On?“ von MARVIN GAYE habe ich mir mindestens zwanzig mal hintereinander über Kopfhörer angehört.
Wovon wurde dein Bühnencharakter beeinflusst?
Von den Queens und Kings des Showbusiness – MADONNA, IGGY POP, JAMES BROWN, TINA TURNER, ANDY KAUFMAN und KATE BUSH. Das sind Leute, die ihrem Publikum das gewisse Extra geben. Sie haben verstanden, dass es wichtig ist, sein Publikum zu respektieren. Deshalb lege ich mich auch so sehr ins Zeug, selbst wenn ich nur vor ein paar Leuten spiele.
Hattest du denn überhaupt eine Wahl? Schließlich stehst du ganz allein auf der Bühne und kannst dich nicht hinter einer Band verstecken.
Da hast du wohl Recht. In anderen Bands bin ich viel zurückhaltender. Da ich aber nur meinen IPOD als Unterstützung habe, muss ich mir überlegen, wie ich die Leute in den Bann ziehen kann. Das bedeutet, dass ich viel mehr tanzen muss, als ich es tun würde, wenn ich einen Drummer und eine Band hätte, die mir den Rücken stärken. Alle Verantwortung liegt bei mir, ich habe nichts zu verlieren und kann nur gewinnen.
Deine Liveshow ist State of the Art. Ich habe in Berlin in letzter Zeit viele Künstler gesehen, die sich ihrem Publikum allein gegenüberstellten, mit nichts anderem als ein paar Playback-Sounds oder einer Gitarre. Was ist der Grund dafür?
Ich finde es wesentlich entspannter solo aufzutreten. Wenn ich jetzt auf Tour gehe, muss ich nichts weiter mitnehmen als ein Sportsakko und meinen IPOD. Davor hatte ich immer mit so vielen Dingen zu kämpfen: dem vielen Equipment sowie den Terminkalendern, Ambitionen und Problemen meiner Bandmitglieder. Dennoch sind Solo-Projekte eine triste Angelegenheit. Es ist schwieriger sich zu motivieren, alles ist so unsozial und selbstzentriert, ganz zu schweigen von der Energie, die in Kollaborationen steckt. Ich habe auch eher das Gefühl, dass diese Soloprojekte ein Berlin-Ding sind. Die Leute ziehen sich in den Wintern immer so sehr zurück, kein Wunder also, dass sie auch allein Musik machen.
Weißt du schon, wie du dein erstes Album gestalten willst?
Daran arbeite ich gerade. Vielleicht mache ich ein Live-Album draus, um die Energie meiner Shows einzufangen. Ich könnte mir vorstellen, es wie TOM WAITS zu machen, der zu den Aufnahme-Sessions für Nighthawks at the Diner ein paar Leute in sein Studio einlud, um vor ihnen zu spielen. Vielleicht stelle ich aber auch ein Mixtape zusammen mit all meinen bisherigen Demo-Aufnahmen, unveröffentlichten Songs und neuen Singles darauf. Wo befindest du dich eigentlich im Augenblick? Ich bin in in meiner Galerie und lausche den Geräuschen, die SOL mit ihrem Tacker im Nachbarzimmer macht. Sie zieht gerade eine neue Leinwand auf.
—
Links: HUSH HUSH / KINDERHOOK & CARACAS / FEATHER THROAT
Foto: MATTHIAS HEIDERICH